REMID
Religionswissenschaftlicher Medien- und Informationsdienst e. V.
Mitgliederzahlen: Judentum

Das Judentum ist eine der ältesten monotheistischen Religionen der Welt. Die Wurzeln reichen über 3000 Jahre zurück, bis zu den Erzählungen über Abraham, der in der jüdischen Tradition als Stammvater gilt. Die zentrale Idee des Judentums ist der Glaube an einen einzigen, unsichtbaren und gerechten Gott, der einen Bund mit dem Volk Israel geschlossen hat. Das wichtigste religiöse Dokument ist die Tora, die die fünf Bücher Mose umfasst. Sie ist Teil des Tanach, der dem christlichen „Alten Testament“ entspricht, aber anders aufgebaut ist. Die rabbinische Auslegung der Tora ist im Talmud gesammelt, einem umfangreichen Werk, das über Jahrhunderte hinweg entstanden ist und bis heute die jüdische Praxis prägt.
Am Schabbat – der Ruhetag von Freitagabend bis Samstagabend – gehen praktizierende Juden in die Synagoge zum gemeinsamen Gottesdienst, der in der Regel ausschließlich auf Hebräisch abgehalten wird und in dem Frauen und Männer in den meisten Strömungen räumlich getrennt sitzen. Zu den wichtigsten Feiertagen zählen Pessach (Erinnerung an den Auszug aus Ägypten), Rosch Haschana (Neujahr) und Jom Kippur (Versöhnungstag). Religiöse Gebote aus der Tora und dem Talmud (Halacha) betreffen auch Speisevorschriften (Kaschrut) und ethisches Handeln. Der Jüdische Kalender (Halūach haʿIvrī) unterscheidet sich vom Gregorianischen Kalender um 3760 Jahre, denn nach jüdischer Überlieferung wurde die Welt 3760 Jahre v. Chr. erschaffen.
Wie alle Religionsgemeinschaften ist auch das Judentum in sich vielfältig, mit verschiedenen ethnischen Gruppen und religiösen Strömungen. Die wichtigsten Strömungen sind: Reformjudentum bzw. progressives Judentum, Konservatives Judentum und Orthodoxes sowie ultraorthodoxes Judentum. Sie entstanden vor allem in Auseinandersetzung mit der Aufklärung und dem Wunsch nach sozialer und wirtschaftlicher Emanzipation, insbesondere in Deutschland. Durch die Auswanderungswellen aus West- und Osteuropa im 19. Jahrhundert und die Ermordung und Vertreibung des Großteils der jüdischen Bevölkerung in Europa während des NS-Regimes, verlagerte sich die wissenschaftliche und theologische Weiterentwicklung in die USA. Die verschiedenen Strömungen unterscheiden sich vor allem darin, wie die Halacha ausgelegt und im Alltag umgesetzt werden und wer jüdisch sein kann. Orthodoxe und Konservative Auslegungen betrachten nur diejenigen als jüdisch, deren Mutter jüdisch ist. Zwar gibt es im Konservativen Judentum die Möglichkeit zur Konversion, aber nur im Reformjudentum werden auch diejenigen als Juden anerkannt, die nur einen jüdischen Vater haben.
Die offizielle Quelle für statistische Daten zur jüdischen Bevölkerung in Deutschland ist der Zentralrat der Juden in Deutschland. Die ihm zugehörige Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) gibt dazu jedes Jahr aktuelle Mitgliederzahlen heraus. Daneben gibt es noch die Union Progressiver Juden, die allerdings sehr viel kleiner ist. Auf Grundlage dieser Quellen bemisst sich die jüdische Bevölkerung auf rund 90’000 Mitglieder.
Das Judentum ist allerdings mehr als eine Religion im christlichen Sinne, denn bis zur Aufklärung wurde nicht zwischen einem religiösen und profanen Raum unterschieden. Alles war religiös – von der Geschichte des jüdischen Volkes bis zum alltäglichen Leben. Es gibt daher auch heute viele jüdische Menschen, die ihre jüdische Identität nicht religiös, sondern kulturell oder ethnisch definieren. Für sie ist es daher kein Widerspruch, nicht Mitglied einer Synagogengemeinde und womöglich auch nicht religiös praktizierend zu sein und sich dennoch als jüdisch zu verstehen. Die Gesamtzahl jüdischer Menschen in Deutschland – mit und ohne formelle Mitgliedschaft – wird daher häufig auf 200’000 geschätzt.
Diese Annahme lässt sich auch dadurch plausibilisieren, dass der Großteil der jüdischen Menschen in Deutschland in den 1990er Jahren aus der ehemaligen Sowjetunion als sogenannte Kontingentflüchtlinge nach Deutschland kam (laut BAMF mehr als 200’000 Menschen seit 1993). Das Kontingentflüchtlingsgesetz, das zunächst in der DDR erlassen worden war, erlaubte es, ohne formales Asylverfahren einen unbefristeten Aufenthaltsstatus in Deutschland zu erhalten. Entscheidend für das Gewähren des Aufenthaltstitels war lediglich der Nachweis, Nachkommen eines jüdischen Elternteils zu sein. Jüdische Identität wurde also sowohl patrilinear, entsprechend dem sowjetischen System definiert, als auch matrilinear, wie die meisten jüdischen Gemeinden in Deutschland bis heute. Sowjetische Juden unterschieden sich in ihrer Religiosität und der Erinnerungskultur an die Shoah deutlich von den bis dahin in Deutschland lebenden Juden. So waren die meisten eingewanderten Juden kaum religiös sozialisiert und behielten eine starke Identifikation mit ihren Herkunftsländern und ihrer russischen Muttersprache. Sie waren außerdem nicht mit dem Narrativ einer historischen Schuld, sondern einem Sieg über Hitler-Deutschland aufgewachsen, was sich deutlich von der Erinnerungskultur Westdeutschlands unterschied.
Seit den 2000er Jahren zog es auch viele mehrheitlich junge jüdische Menschen aus Israel nach Deutschland, insbesondere Berlin. Die Zahl lässt sich nur schwer schätzen; sie reicht von 6000 bis 30’000.
Insgesamt rechnet REMID aktuell (Stand 2022) mit 90.885 Jüd*innen. Die “Jüd*innen ohne Gemeindezugehörigkeit” sind in dieser Zahl nicht enthalten. Für die sogenannten “messianischen Jüd*innen” siehe unter Sonstige.
90.478
2023/ Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland e.V. ZWST. Schlüssel als KdÖR (einige Gemeinden altkorporiert): ikg, j, isnw, sg oder jgd.
Statistische Entwicklungen
| Jahr | Mitgliederzahl | Zuwachs/Rückgang |
| 2023 | 90.478 | -407 |
| 2022 | 90.885 | -2.810 |
| 2020 | 93.695 | -1.076 |
| 2019 | 94.771 | -1.554 |
| 2018 | 96.325 | -1.466 |
| 2017 | 97.791 | -809 |
| 2016 | 98.600 | -1.101 |
| 2015 | 99.701 | -742 |
| 2014 | 100.443 | -901 |
| 2013 | 101.344 | -797 |
| 2012 | 102.141 | -662 |
| 2011 | 102.803 | -1227 |
| 2010 | 104.030 | -1227 |
| 2007 | 105.257 | / |
Mitgliedsgemeinden im Zentralrat der Juden in Deutschland. Davon Zuwanderer*innen aus Osteuropa 2007 (REMID): ca. 101.000
90.000
2007 / REMID.
Durch Zuwanderung aus Osteuropa nach Deutschland gekommen, religiöser Status im Sinne der jüdischen Religionsgesetze oft unklar.
4.000–4.500
in 9 Gemeinden, 2023
Mediendienst Integration.
Statistische Entwicklungen:
| Jahr | Mitgliederzahl | Zuwachs/Rückgang |
| 2023 | 4.000–5.000 | -200–1.200 |
| 2020 | 5.200 | +200 |
| 2012 | 5.000 | +500 |
| 2007 | 4.500 | +1500 |
| 2004 | 3.000 | / |
| Jahr | Anzahl an Gemeinden |
| 2023 | 19 |
| 2020 | 25 |
| 2015 | 26 |
| 2012 | 24 |
| 2007 | 21 |
| 2004 | 15 |
Die Gemeinden der UpJ sind zum Teil über Landesverbände Mitglied im Zentralrat der Juden in Deutschland. Sie ist seit dem 30. September 2015 eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Bielefeld.
Quellen:
Batnitzky, Leora Faye. 2011. How Judaism became a religion: an introduction to modern Jewish thought. Princeton University Press.
Brenner, Michael. 2011. „Religiöse Erneuerung und Säkularisierung. Ein Überblick“. Archiv für Sozialgeschichte 51: Säkularisierung und Neuformierung des Religiösen. Gesellschaft und Religion seit der Mitte des 20. Jahrhunderts: 225–35.
Della Pergola, Sergio. 2019. „World Jewish Population, 2018“. American Jewish Year Book, American Jewish Year Book, Bd. 118: 361–499. https://doi.org/10.1007/978–3‑030–03907‑3.
Kaplan, Marion. 1994. „What is ‚Religion‘ among Jews in Contemporary Germany?“ In Reemerging Jewish culture in Germany: life and literature since 1989, herausgegeben von Sander L. Gilman und Karen Remmler. New York University Press.
Kauders, Anthony D. 2007. Unmögliche Heimat: eine deutsch-jüdische Geschichte der Bundesrepublik. 1. Aufl. Deutsche Verlags-Anstalt.
Kiesel, Kieron. 2010. „Neuanfänge: Zur Integration jüdischer Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland“. In Juden in Deutschland, Deutschland in den Juden: neue Perspektiven, herausgegeben von Y. Michal Bodemann und Micha Brumlik. Wallstein.
Körber, Karen. 2017. „Contested Diaspora: Negotiating Jewish Identity in Germany“. In Diaspora as Cultures of Cooperation, herausgegeben von David Carment und Ariane Sadjed. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978–3‑319–32892-8_2.
Mahla, Daniel. 2021. „Juden in Deutschland und der Staat Israel“. bpb.de. https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/izpb/juedisches-leben-348/juedisches-leben-348/341633/juden-in-deutschland-und-der-staat-israel/.
Solomon, Norman. 2022. Das Judentum: eine kleine Einführung. Übersetzt von Ekkehard Schöller. Reclams Universal-Bibliothek Sachbuch, Nr. 14268. Reclam.
Stemberger, Günter. 2015. Jüdische Religion. 7., Durchgesehene Auflage. Verlag C.H. Beck.
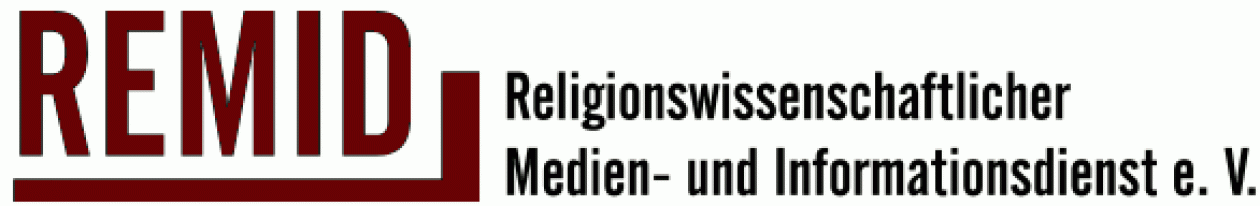
![[Antisemitische Karikatur, „Hinter der russischen/ukrainischen Maske strebt der Jude nach Konflikt“]](https://remid.de/wp-content/uploads/2023/05/Verschwoerungsmythen-e1702987919642.png)

