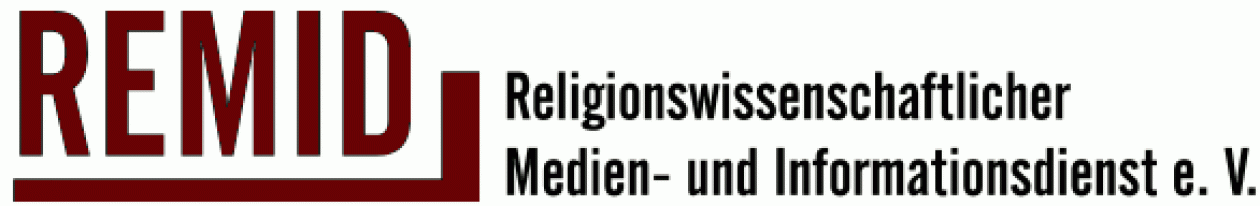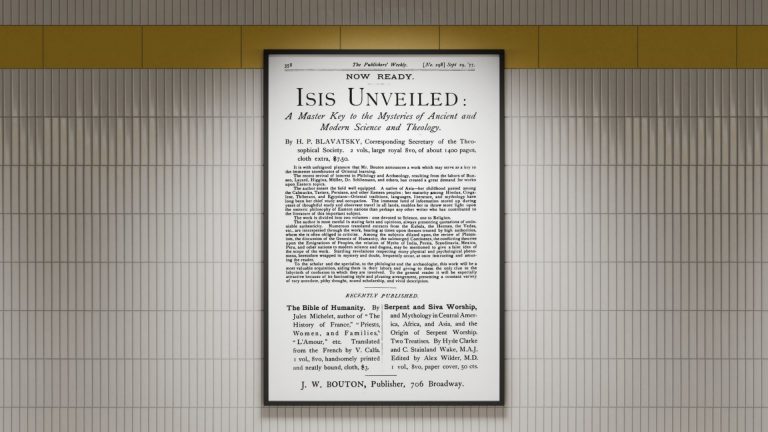REMID
Religionswissenschaftlicher Medien- und Informationsdienst e. V.
Zu Beginn meines Studiums der Religionswissenschaft hörte ich folgende Anekdote:
In der britischen Kolonialzeit wurde in der indischen Bevölkerung eine Umfrage durchgeführt, um die Religionszugehörigkeit zu erheben. Es gab feste Boxen zum Ankreuzen, also so etwas wie „Christian“, „Muslim“, „Hindu“. Viele Menschen wussten nichts mit diesen Kategorien anzufangen, daher kreuzten sie nichts an oder fanden eigene Beschreibungen und Erklärungen. Die Geschichte sollte uns als Studierenden das Problem von Umfragen bzw. religiösen Kategorien verdeutlichen.1
Da ich selbst eine Person bin, die zwar christlich aufgewachsen ist, aber ihren Glauben nicht (mehr) in festen Kategorien denkt, hat mich das fasziniert und ich war von dort an entschlossen, mehr über das Religionsverständnis in Indien und den dort verbreiteten Glaubensformen herauszufinden. Mich interessierte besonders, was als „Hinduismus“ beschrieben wird.
In der Schule hatte ich mich bereits mit „dem Hinduismus“ beschäftigt. Wir hatten etwas über die Totenbestattung durch Krematorien gelernt, über die Diskriminierung von „Unberührbaren“ (Dalits) durch das Kastensystem und sehr spärlich etwas über Bräuche am Lichterfest Diwali. Für einen Test mussten wir ein paar „Götternamen“ und weitere Begriffe wie „Karma“ auswendig lernen.

Ich nutzte sowohl Studium und Freizeit, um immer mehr zu lernen. Die geisteswissenschaftliche Methode, auch bekannt als hermeneutischer Zirkel besagt, dass es hilft, ein Vorverständnis von einer Sache zu haben. Dieses Vorverständnis wird dann aber in vielen neuen Verständnisprozessen korrigiert und verfeinert. Im Fall von Religion heißt das: Ich versuche immer, neue Perspektiven einzubinden, um pluraler hinsehen zu können.
Die Hindu-Vielfalt studieren
In meinem Studium belegte ich zwei für mein Vorhaben relevante Seminare. Ich lernte den nicht idealen, aber für uns religionswissenschaftlich dienlichen Begriff der „Hindu-Traditionen“. Dieser beinhaltet noch das populär geläufige „Hindu“ (im Grunde eine geographische Bezeichnung, wörtl. „Fluss“) und verrät gleichzeitig schon seine Vielfalt. Sanatana Dharma ist eine der Eigenbezeichnungen für Hindu-Traditionen und heißt so etwas wie „ewiges Gesetz“. Ich hörte von den zwei prominentesten Kategorien für Glaubensgemeinschaften innerhalb der Hindu-Traditionen, Vaishnavas und Shaivas.2 Sie verehren jeweils in monotheistischem Verständnis die Gottesformen Vishnu oder Shiva.
Ich las das Erzählgedicht Bhagavad Gita („Lied des Herrn“)3: Hier offenbart sich Krishna (eine Inkarnation bzw. ein Avatar Vishnus) dem Wagenlenker Arjuna als allumfassender, mächtiger Gott und vermittelt ihm Weisheitslehren über die Einstellungen zu Existenz und Tod, die Mut und Gelassenheit im bevorstehenden Kampf stärken sollen.4
Außerdem lernte ich in einem Semester die vielfältige Geschichte von Yoga kennen. Prominent war das Verständnis von Yoga als „Verpflichtung zur Selbsttranszendenz“. Dies unterscheidet sich vom alltäglichen Nutzenverständnis von Yoga als Stärkung von Körper und Geist. Innerhalb des Seminars waren wir dann auch zu einer Yogastunde eingeladen.

Über Krishnas Butterliebe lesen
Ich las ein Buch mit kleinen Geschichten über Krishna und kam nicht daran vorbei, Krishna immer wieder mit Jesus im Christentum zu vergleichen — unser Verständnis von Anderem ist häufig geprägt von Erzählungen, die wir aus dem eigenen Kontext kennen. Eine Inkarnation Gottes, gütig alle liebend, durchs Land ziehend, heilend, Wunder vollbringend. Aber natürlich gab es da auch große Unterschiede. Die Mythologie, in die Krishna eingebettet ist, liest sich als Geschichte eines Herrschergeschlechts, geprägt vom Kampf zwischen Gut und Böse, aber auch von vielen Listen und Intrigen.
Was mir auffiel, war die kindliche Seite von Krishna. In seinen jungen Jahren wird seine Lust nach Butter betont und wie er durch geschickte, aber liebevolle Manipulation seiner Familie, Freunde und Nachbarn immer wieder an riesige Buttervorräte gelangte.5
Verehrung im Tempel erleben
Den Tempel Aasamai Mandir („Hoffnung der Mutter“) in Frankfurt am Main habe ich als einen gemeinschaftlichen Ort wahrgenommen. Er ist zweigeteilt in einen Speiseraum und einen Raum für die Verehrungspraxis. Darin herrscht stets ein leicht würziger Geruch, und während der belebten Wochentage kann ich singenden Stimmen und Perkussionsinstrumenten lauschen. Die Götterfiguren sind in einem Schrein aufgereiht. Während der Versammlungstage läuten die Menschen eine Glocke, verbeugen sich, laufen um den Schrein herum, und legen ausgewählten Figuren etwas Kleines hin, meist etwas zu essen.
Diese Gemeinschaft ist der „Afghan Hindu Kulturverein“. Ein Vertreter war einmal in einem Seminar bei uns zu Gast, um von der Geschichte und Kultur der Hindus in Afghanistan und der heutigen Diaspora-Situation aufgrund religiöser Verfolgung durch die Taliban zu erzählen.6
Daraufhin entschied ich mich, diese Gemeinschaft zu besuchen, um einen Forschungsbericht zu schreiben. Meine hier gemachten Erfahrungen wären sicher noch einen eigenen Blogartikel wert, ich will hier nur kurze weitere Schlaglichter werfen: Mir gegenüber wurde mehrfach das monotheistische Verständnis eines einzigen Gottes hinter den vielen Figuren betont. Unter afghanischen Hindus gäbe es kein Kastensystem; grundlegend wie in allen Religionen sei, dass der Mensch das Wichtigste ist. Aus der Bhagavad Gita werden zwei zentrale Aussagen hervorgehoben: Tu gute Taten. Nimm nichts, was dir nicht gegeben wird.
Menschen nach ihrem „Hinduismus“ befragen
Ich begegnete so einigen Menschen, die mein Verständnis von Hindu-Traditionen erweiterten.
Die Traditionen sind präsent im Leben:
Als ich mit einer Gruppe einen weiteren Hindu-Tempel in Frankfurt besuchte, brachte uns eine Frau ausführlich nah, welche Rolle Gottesfiguren im Alltag spielen. Sie werden in das Leben eingebunden und wie Menschen behandelt. Ihnen wird Essen dargeboten, sie werden gewaschen, sie werden eingekleidet und geschmückt. Ihnen werden Sorgen erzählt.
Sie sind offen:
Ich begegnete einem anglikanischen Pfarrer aus Indien, der Krishna mit Gesang und Tanz verehrte.
Sie sind eine Verbindung zur Heimat:
Ich traf einen Menschen aus Indien, der in Deutschland sein Doktorstudium absolvierte. Er bezeichnete sich selbst als Atheist und besuchte dennoch hier Tempel, um Traditionen zu pflegen und Gemeinschaft zu erleben.
Sie werden auch „säkular“ und missionarisch verstanden:
In einem TikTok Live begegnete ich einem Streamer, der zum einen in apologetischer Absicht vom Hinduismus erzählte, zum anderen klar machte, dass Hinduismus KEINE Religion, sondern eine Philosophie sei. Krishna sei kein Gott, den er verehrte, sondern sein tatsächlicher geschichtlicher Vorfahre. Die Bhagavad Gita sei eine bloße Weisheitslehre und Yoga sei eine Praxis, die das Leben von allen Menschen auf der Welt zum Guten führen könne. Er war stolz darauf, dass Yoga als „trojanisches Pferd“ Hinduismus heraus aus seinem Land in alle Welt bringt.
Orte gelebten Glaubens bereisen
Während meiner einmonatigen Reise durch Indien vor zwei Jahren hatte ich viele Gespräche über Glaubensformen – mit Studierenden, Ärzt:innen, Gläubigen und Skeptiker:innen.

Ein Doktorand aus Mumbai beschrieb den Hinduismus als eine Religion mit Tausenden von Göttern, bei der stark Feste, Traditionen und eine animistische Weltsicht im Vordergrund stehen. Ein weiterer Doktorand äußerte ambivalente Gefühle: Einerseits sehe er positive Einflüsse, andererseits nehme Religion auch Freiheiten – vor allem die der persönlichen Entscheidung. Das Navigieren zwischen unterschiedlichen Glaubenssystemen sei eine Herausforderung – wie soll ein Mensch den richtigen Weg finden? Besonders eindrücklich war auch ein Schild an einem Zaun, auf dem stand: „My definition of religion is to be in tune with nature.“
Hindu-Traditionen werden häufig prominent mit dem Kastensystem in Verbindung gebracht, das Menschen hierarchisch in die Gruppen Brahmana (Brahmins), Kshatriya (Krieger), Vaishya (Bauern und Kaufleute), Shudra (Diener) einteilt.7 Gesetzlich ist es abgeschafft, dennoch trennt es weiterhin die Gesellschaft und begründet Diskriminierung, vor allem von Kastenlosen. In Vorträgen wurde mir erklärt, dass es früher eine gewisse Durchlässigkeit zwischen den Kasten (cast mobility) gab, die heute nicht mehr so existiert. Es gibt jedoch Versuche, das ursprüngliche flexible Verständnis von Kaste (varna) wiederzubeleben. Im Prinzip sind alle Lernenden als Brahmins (höchste Kaste) zu verstehen. Wer die Tätigkeit des Putzens ausführt, ist in diesem Moment Shudra oder wer verkauft, Vaishya. Im Prinzip sei es eine Berufsbezeichnung.8
Ein Arzt aus der indigenen Rathwa-Gemeinschaft in Gujarat erklärte mir: „Dharma can give way of life, that’s why we believe in a God“. So würde das Denken der Menschen geordnet. Der Begriff Dharma wird oft als „Religion“ verstanden, heißt aber in erster Linie Wahrheit, Gesetz oder Pflichten der Hindu-Traditionen.9 Und eine junge muslimische Frau sagte zu ihrem Mitfeiern in der Farben- und Wasserschlacht beim Frühlingsfest Holi: „I celebrate all festives, because I am a human being“.
Diese Stimmen zeigen, dass Religion in Indien nicht als festes Dogma verstanden werden muss, sondern genauso als komplexes, lebendiges Geflecht aus Alltag, Identität und Spiritualität gelebt wird.10
Fazit
Eins der wichtigsten Take-Aways vom ersten Semester der Religionswissenschaft ist es, Religionen und Glaubensrichtungen nicht zu essentialisieren, sondern plural zu denken. Ich möchte einige der hier dargestellten Erkenntnisse zusammenfassen:
- Viele Hindus sehen sich selbst als Monotheisten mit jeweils einer prominenten Gestalt, in der sie Gott verehren. In der Schrift Bhagavad Gita findet sich eine Art Pantheismus, also die Gleichsetzung Gottes mit dem Universum.
- Hindus haben nicht nur eine lange Geschichte in Indien, sondern auch in anderen Ländern, wie Afghanistan.
- Es geht, wie bei den meisten Religionen, für jeden um etwas anderes. Dem einen sind Traditionen wichtig, dem anderen die philosophische Wahrheitssuche.
- Es gibt auch ein säkulares Verständnis der Gottesinkarnationen als Vorfahren.
Jede weitere Begegnung und Auseinandersetzung hat das Potenzial, diese Verständnisse zu bereichern.
Chiara Pohl, B.A. Religionswissenschaft, Goethe Universität Frankfurt.
Dieser Blogartikel entstand im Rahmen der Spring School RelWissKomm 2025
Quellenverzeichnis
- Friedlander, P. (2007). Religion Race, Language and the Anglo Indians: Eurasians in
the census of British India. https://www.academia.edu/1826058/Religion_Race_Language_and_the_Anglo_Indians_Eurasians_in_the_census_of_British_India. ↩︎ - Mall, R. A. (1997). Der Hinduismus: Seine Stellung in der Vielfalt der Religionen. Primus Verlag: 62. ↩︎
- Knott, K. (2000). Hinduism: A very short introduction. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/actrade/9780192853875.001.0001: 15f. ↩︎
- Mylius, K. (Hrsg ). (1997). Die Bhagavadgītā: Des Erhabenen Gesang (Vollst. Ausg.). Dt. Taschenbuch-Verl. ↩︎
- Vilas, S. (2021). The Little Blue Book on Krishna: Prakash Books. ↩︎
- Singh, I. (2019). Afghan Hindus and Sikhs: History of a thousand years. Readomania. ↩︎
- Knott, 2000, S.19. ↩︎
- Mall, 1997, S.4. ↩︎
- Knott, 2000, S.20f. ↩︎
- Mall, 1997. S.11f. ↩︎